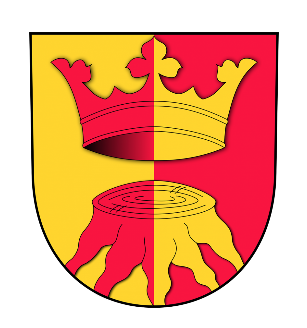[Harzkäse]
[Das Wappen]
[Übersicht]
[Vorgeschichtliche Funde]
[Ein Blick durch das Kaleidoskop]
[Aus alten Urkunden]
[Kurzer einfeltiger nothwendiger Bericht]
[Der Harzer hat das Käsebacken überdauert]
[Rundgang durch das alte Dorf]
[Entwicklung der Landwirtschaft]
[Der grosse Hof]
[Die Flurnamen]
[Geschichten aus dem Knauf]
[Doch einen Bahnhof wollten sie nicht]
[Warum Immenrode keine Badeanstalt bekam]
[1000 Jahre dazwischen]
[Als der Krieg zu Ende war]
[Doeneken]
[Unser Okerstand]
[Viele Bruennlein fliessen]
[Wieder Chancen für die Weddekrebse]
[Das Ende 886 Jahre nach der ersten Währung]
[Einigkeit macht stark]
[Wer will fleißige Handwerker sehn]
[Hol mir mal die Suelzepresse]
[Über 100 Jahre Schützentradition]
[Brieftaubensportverein ‚Harzbote-Immenrode‘]
(Berichte von »Einheimischen« und »Vertriebenen«, gesammelt und aufgeschrieben von Paul-Otto Gutmann)
Die zwölf Jahre der Naziherrschaft werden in Immenrode – wie wohl überall in Deutschland – als bedrückender Zeitabschnitt empfunden. Natürlich »hatte man mitgemacht«, »…man musste ja mitmachen, im Jungvolk, in der Hitlerjugend, im BDM…« und Goslar war ja »Reichsbauernstadt«, und das hatte auch Auswirkungen nach Immenrode…
Aber erzählen aus dieser Zeit? Was soll man da erzählen? Es war eben wie überall. Und direkt schuldig ist ja auch keiner geworden. Das bittere Ende kam ja dann. Je länger der Krieg dauerte, desto öfter musste Hermann Giesecke die schlimme Nachricht in die Häuser tragen: »…Gefallen für Führer und Vaterland…« Aber dann war endlich der Krieg zu Ende.
Adolf Jerxsen erinnert sich:
(A. Jerxsen, Jg. 1906, übernahm sofort nach Kriegsende Verantwortung für Immenrode, zuerst als Kassenleiter, dann als Bürgermeister und seit 1946 als Gemeindedirektor und Standesbeamter. Diese beiden Ämter versah er bis zu seiner Pensionierung im Jahre 1972).
Am 3. Dezember 1944 wurde ich in Jugoslawien verwundet und verlor ein Bein. Ich kam ins Lazarett nach Villach. Im Februar 1945 besuchte mich dort mein Sohn Günter, um mich nach Hause zu holen. Und wir machten uns auch auf den Weg. Das muss man sich heute einmal vorstellen. Die meisten größeren Bahnhöfe waren zerbombt. Fahrpläne gab es schon lange nicht mehr, und Günter musste mich »Huckepack« von Zug zu Zug tragen. Aber wir haben es geschafft, und ich kam nach Goslar ins Lazarett. Dort hörten wir natürlich Nachrichten. Als die Amerikaner immer näher kamen, riss ich aus und humpelte auf Krücken nach Immenrode. Ich hatte ja nichts zu befürchten, da ich nie in der »Partei« gewesen war. Und so wurde ich dann auch nach Kriegsende gleich mit allerlei Ämtern betraut. Es war eine harte Zeit, die an alle – Einheimische wie Vertriebene – hohe Anforderungen stellte an Einsicht, Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft. Die Gastwirtschaft »Zur Post« war geschlossen und diente bis zur Zimmerverteilung als Auffanglager.
In den ersten bei den Nachkriegsjahren trafen immer neue Flüchtlinge und Vertriebene ein, erst aus West- und Ostpreußen, dann aus Schlesien. Immenrode hatte in der Vorkriegszeit 880 Einwohner; diese Zahl wuchs auf über 1600. Die eingesessenen Immenröder mussten immer weiter zusammenrücken, und die Flüchtlinge brachten oft nur das mit, was sie auf dem Leibe trugen.
Wer ein Federbett mitbringen konnte, war schon glücklich dran.
Als Bürgermeister und von 1946 ab als Gemeindedirektor hatte ich für die Unterbringung der Flüchtlinge und Vertriebenen zu sorgen. Bei den Immenrödern schieden sich da die Geister. In vielen Häusern bot man freiwillig so viel Wohnraum an, wie man nur freimachen konnte. Die armen Menschen, die da aus dem Osten kamen, hatten ja alles verloren, und so half man, so gut man konnte. Es gab aber auch Häuser, in denen wir beschimpft und bedroht wurden. Heute erscheint es mit wie ein Wunder, dass wir mehr Flüchtlinge unterbringen konnten, als Immenrode ursprünglich Einwohner hatte…
Begehrteste Arbeitsplätze waren die bei den Bauern. Dort erhoffte man sich eine Aufbesserung der sonst so kärglichen Lebensmittelrationen. Und sonst wurde jede Gelegenheit genutzt, zusätzliche Lebensmittel zu ergattern. Nicht nur, dass der »schwarze Markt« blühte. Je nach Jahreszeit zog alles aus zum Ährenlesen, Pilze und Bucheckernsammeln, Kartoffel- und Rübenstoppeln. Die Rübenpresse war Tag und Nacht unterwegs. Überall wurde Sirup gekocht und Rübenschnaps gebrannt; denn Spirituosen gab es ja nicht zu kaufen. Schlange stand man bei Bäcker Döhrmann nach Maisbrot – so lange es frisch war, schmeckte es ganz gut -, bei den Schlachtern nach Wurst- und Fleischbrühe und bei Kaufmann Heverhagen, heute Thielemann, nach Heringslappen und Rogen, um auch mal eine Fischmahlzeit zu haben. Die Hausfrauen entwickelten sich zu wahren Kochkünstlerinnen; ohne die gewohnten Zutaten wurden die tollsten Gerichte gezaubert.
Die gleiche Phantasie und viel Geschick wurden auch für die Kleidung aufgebracht. Was wurde da alles aus alten Decken genäht, und die Wäsche wurde so oft gestopft und geflickt, bis es wirklich nicht mehr ging. Die Wälder rings um Immenrode waren wohl noch nie so gut aufgeräumt. Jedes Stück Brennholz wurde gesammelt. Aber allmählich richtete man sich ein, und das Leben normalisierte sich. Die Männer kehrten aus Krieg und Gefangenschaft zurück. Das ging dann wieder wie ein Lauffeuer durch das Dorf; vor allem, wenn ein Vertriebener seine Familie wiedergefunden hatte. Und nach der langen trüben Zeit wollte man auch wieder feiern und fröhlich sein. Nachbarschaft, Geselligkeit und Gemeinschaft hatten einen höheren Wert als heute. Deshalb war es wichtig, das Vereinsleben wieder in Gang zu bringen. 1946 fuhr ich mit Lehrer Etzrodt, dem Chorleiter des Gesangvereins, zur Militärregierung nach Goslar, um wenigstens das Singen wieder zu ermöglichen. Dies wurde auch genehmigt, nur Heinrich Barmann, der bis zum Kriegsbeginn Vorsitzender gewesen war, musste noch auf seine Entnazifizierung warten. Und so musste ich zunächst den Vorsitz übernehmen.
Und so kam das Vereinsleben langsam wieder in Gang und führte Einheimische und Flüchtlinge zusammen. Die ersten »Bräute ganz in Weiß« waren wieder zu bewundern, und es gab die ersten Liebschaften zwischen Eingesessenen und Vertriebenen. Aber bis es zu Eheschließungen kam, waren manche Hindernisse zu überwinden. Was heute selbstverständlich ist, war damals ein großes Problem und meist mit häuslichem Krach verbunden.
Jahrhunderte lang hatte man in den Dörfern »über die Straße« geheiratet, und wir erleben ja schon heute, wie günstig sich diese »Blutauffrischung« ausgewirkt hat…
Frieda Gunder (Jg. 1904) und Willi Gunder (Jg. 1938) berichten:
Unsere Familie lebte in Breslau; die vier Kinder wurden 1931,1933, 1935 und 1938 geboren. Unser Vater war seit Kriegsbeginn Soldat. Am 22. Januar 1945 flüchteten wir zur Großmutter nach Pfaffendorf im Eulengebirge. Aber auch dort konnten wir nicht bleiben und flüchteten weiter nach Wüstewaltersdorf Kreis Waldenburg. Dort erlebten wir den Einmarsch der Russen und das Kriegsende. Am 11. Mai 1945 kehrten wir nach Pfaffendorf zurück. Dort war erst russische, dann polnische Besatzung. Fast ein Jahr konnten wir in Pfaffendorf bleiben, bis zum 13. April 1946. Da wurden wir endgültig vertrieben. Wir durften nur mitnehmen, was wir tragen konnten. Das Schlimmste war, dass wir bis dahin noch nichts von unserem Vater gehört hatten. In Reichenbach wurden wir in Güterwagen verladen und in ein Lager nach Salzgitter-lmmendorf gebracht. Von dort aus ging es weiter nach Goslar in die Vititorkaserne. Am 2. Mai 1946 wurden wir mit einem LKW nach Immenrode transportiert, aber da war noch keine Wohnung frei, und wir mussten nach Goslar zurück.
Beim zweiten Versuch am 6. Mai klappte es dann. Wir wurden beim Bauern Otto Ehlers einquartiert.
Die beiden jungen Bauern Otto und Helmut Ehlers waren damals noch unverheiratet, die Mutter war kränklich, und so war eine tatkräftige Hilfe im Haushalt, im Kuhstall und auf dem Felde hochwillkommen. Es war gar nicht so einfach, die vier Kinder einzukleiden. Pullover wurden aus aufgeribbelten Zuckersäcken gestrickt, Hosen und Jacken aus alten Wolldecken genäht. Das Verhältnis zu der Familie Ehlers war von Anfang an sehr gut. Einmal hat unsere Annelies in Goslar eine Frau getroffen. Die hat erzählt, sie kenne unseren Vater. Er würde leben und sich in einem Lager in der DDR befinden. Dort könnte die Frau ihn herausholen. Dazu brauchte sie aber Geld und Lebensmittel. Da wir uns an jeden Strohhalm klammerten, glaubten wir das und haben alles, was wir besaßen, zu der Frau nach Goslar gebracht. Wenige Tage später kam die Nachricht, dass unser Vater kurz vor Kriegsende noch bei Kämpfen an der Mosel gefallen ist. Von der Schwindlerin haben wir natürlich nie wieder etwas gehört oder gesehen…
Karl Scholz (Jg. 1900) erzählt:
Bis zum Kriegsausbruch lebte ich mit meiner Frau und unseren vier Kindern, die 1928, 1930, 1935 und 1938 geboren wurden, glücklich in Freiwalde in der Grafschaft Glatz. Dann wurde ich eingezogen und will von den Kriegserlebnissen weiter nichts erzählen. Im August 1944, bald nach meinem letzten Heimaturlaub, wurde ich in den Pyrenäen von französischen Widerstandskämpfern gefangengenommen. Wir wurden in ein Lager bei Bordeaux gebracht und arbeiteten in einem Salpeterwerk. Zwei Jahre lang hörte ich nichts von meiner Familie. Im Juli 1946 gelang es einem französischen Franziskanerpater, über die CSR und die Schweiz, eine Postverbindung herzustellen. Da erfuhr ich, dass im Februar 1945 unser fünftes Kind, unsere Tochter Dorli, geboren war. Wir hofften täglich auf unsere Entlassung. Aber erst zweieinhalb Jahre nach Kriegsende ließen uns die Franzosen frei. Am 17. November 1947 konnte ich endlich meine tapfere Frau und die Kinder in die Arme schließen. Sie waren inzwischen aus der Heimat vertrieben und wohnten in Immenrode. Ich kann gar nicht sagen, wie dankbar ich unserem Herrgott bin, dass wir alles, den Krieg, die Gefangenschaft, die Vertreibung gesund überstanden hatten. Alles andere kann nun meine Frau erzählen
Maria Magdalena Scholz (Jg. 05) erzählt:
In unserem Dorf Freiwalde lebten nur Deutsche. Am 10. Mai 1945 kamen russische Soldaten und plünderten auch unser Haus. Unsere Töchter mussten sich immer verstecken. Mir taten die Russen nichts, weil ich immer unsere vierteljährige Tochter Dorli auf dem Arm trug. Nach den Russen kamen Tschechen und holten fünf Männer ab, von denen man nie wieder etwas gehört hat. Und dann wurden Polen nach Freiwalde gebracht. In unser Haus kamen drei Männer. Das waren ganz arme Menschen, die man aus Ostpolen vertrieben hatte. Sie hatten nur das, was sie auf dem Leibe trugen. Trotzdem sorgten sie für unsere Kinder und brachten Brot, Milch und Zucker. Auch unser Priester hat sehr viel für uns getan. Der erste polnische Bürgermeister ließ nicht zu, dass ich mit den fünf Kindern aus dem Haus gewiesen wurde. So gehörten wir zu den letzten deutschen Familien in Freiwalde. Aufregungen gab es genug. Unsere drei ältesten Kinder mussten immer Vieh zur Bahnstation Mittwalde treiben, das von dort aus in die Sowjetunion transportiert wurde. Ich lebte in ständiger Angst, ob sie wohlbehalten zurückkommen würden.
Am 28. August 1946 mussten wir von einem Tag auf den anderen die Heimat verlassen. Wir durften nur so viel mitnehmen, wie wir tragen konnten. Die Polen gaben uns einen Sack Brot mit. In Mittwalde wurden wir in Viehwaggons verladen. Über die Lager Immendorf und Vienenburg kamen wir nach Immenrode. Wir wurden in das Haus Vienenburger Str. 13 eingewiesen, das damals zur Mühle gehörte. Wir bekamen zwei leere Zimmer. Zum Glück konnten wir ein paar Federbetten mitbringen, so dass sich die Kinder zudecken konnten. Aber keiner hatte mehr Schuhe, und alle mussten barfuss laufen. In unserem Haus wohnte Frau Minna Diederich, und diese Frau hat für uns gesorgt, so gut sie konnte. Wie groß war die Freude, als uns Arnold von Hof einen alten Ofen brachte. Hans Heik, der damals in der Mühle arbeitete, hat uns öfter mal ein Säckchen Mehl zugesteckt, und Herwart Wolf sen. schenkte uns Kartoffeln. Die gerösteten Kartoffelschalen gab es als Frühstück. Für die eingesessenen Immenröder war es ja auch nicht leicht, so viele Flüchtlinge aufzunehmen. Und so waren wir dankbar für jedes Möbelstück, das wir nach und nach geschenkt bekamen. Als mein lieber Mann im November 1947 aus der Gefangenschaft kam, fand er schon ein „geordnetes Familienleben« vor.
Norbert Scholz (Jg. 1928)
(ist 1952 nach USA ausgewandert. Anlässlich des 85. Geburtstages seines Vaters war er zu Besuch in Immenrode.)
Weil Vater Soldat war, musste ich ihn schon früh in der Familie vertreten. Ich musste mich um die kleinen Geschwister kümmern und beinahe täglich mit dem Fahrrad zum Einkaufen nach Mittwalde fahren, auch für die vielen Frauen in unserem Dorf, deren Männer eingezogen waren. Durch die vielen Pflichten wurde ich früh selbständig und erwachsen. Im März 1945 wurde ich zum Volkssturm eingezogen. Da war ich gerade 16 Jahre alt. Wir mussten Gräben ausheben und Panzersperren bauen. Als die Russen kamen, war ich wieder zu Haus. Meine Mutter hielt wegen meiner Schwestern das Haus immer verschlossen. Einmal arbeitete ich mit einem alten Mann hinter dem Haus. Da kamen zwei Russen mit dem Fahrrad und verlangten, dass wir das Haus aufschließen sollten. Der alte Mann stellte sich ihnen entgegen und fragte, ob sie einen Durchsuchungsbefehl hätten. Da riss der eine Soldat die Maschinenpistole von der Schulter und drückte ab. Der alte Mann sackte zusammen.
Er war im Oberschenkel und im Unterleib getroffen. Die Salve schlug dicht neben mir ein. Die Russen flüchteten. Das Leben des alten Mannes war nicht zu retten.
Dieses Erlebnis werde ich nie vergessen. Dann kamen die Polen und übernahmen die Höfe und die Häuser. Wir mussten für sie arbeiten. Im August 1946 wurden wir ausgewiesen. In Mittwalde wurden 38 Menschen in einen Viehwaggon gepfercht. Mein Freund Horst und ich konnten uns in einem Bremserhäuschen verkriechen. Nachts wachten wir auf, weil es so zog. Die Tür war aufgesprungen, und wir wären um Haaresbreite herausgestürzt. In Deutschland angekommen, kampierten wir mit den Familien Lopatar und Grond im Vienenburger Schützenhaus auf dem Fußboden.
Dann kamen wir nach Immenrode. Meine Mutter konnte mir bald eine Lehrstelle besorgen. Ich lernte Autoschlosser bei Bach in der Molkerei. Ich bekam alte Militärklamotten geschenkt. Nach meiner Gesellenprüfung bewarb ich mich um die Auswanderung nach USA. Im April 1952 erfolgte die Überfahrt. Aber schon sechs Monate später wurde ich in die US-Armee eingezogen und kam als Besatzungssoldat nach Deutschland. Neun Monate war ich in Friedberg in Hessen, sehr zur Freude meiner Eltern und Geschwister. Ich war auch sehr froh. Die Amis hätten mich ja auch in den Koreakrieg schicken können. 1955 konnte ich meine Freundin aus Bündheim in die Staaten nachholen und heiraten.
Unsere Kinder wurden 1956 und 1958 geboren. Es würde zu weit führen, wollte ich all meine Tätigkeiten und Berufe aufzählen, die ich in einem ständigen Auf und Ab ausgeübt habe. Aber jetzt habe ich es geschafft und leite in Kalifornien ein Fernfahrunternehmen. Meine Frau und ich haben die deutsche Staatsbürgerschaft behalten. Die Verbindung zur Heimat und zu unseren Eltern war immer sehr eng. Unser Leben war nicht leicht, aber insgesamt hat es das Schicksal gnädig mit uns gemeint.
Karl und Maria Scholz erzählen:
Nun wohnen wir schon fast vierzig Jahre in Immenrode. Wir sind hier zu Hause und haben viele liebe Freunde gefunden, »Flüchtlinge« und »Einheimische«. Unsere Kinder sind hier aufgewachsen und haben eine eigene Existenz gegründet. So lange wir können, fahren wir zu den Schlesiertreffen.
Dort treffen wir alte Freunde und Bekannte und können Erinnerungen austauschen. Aber nach Freiwalde zieht uns nichts mehr. Dort wohnen jetzt Polen, die man ja auch aus ihrer ursprünglichen Heimat vertrieben hat. Das ist jetzt alles für uns abgeschlossen.
Obwohl wir nach Schlesien reisen könnten, sind wir noch nicht wieder dort gewesen und werden auch nicht fahren. Wir wollen lieber alles so in Erinnerung behalten, wie es früher gewesen ist. Unser Herrgott hat uns ein schweres Schicksal auferlegt. Aber wir sind auch immer wieder bewahrt worden. Und dafür sind wir dankbar, so lange wir leben.
Christel Koch geb. Lopatar (Jg. 1921) erzählt:
Unsere Familie lebte in Wölfelsgrund in der Grafschaft Glatz. Ich war die älteste von sieben Geschwistern, die zwischen 1921 und 1940 geboren wurden. In 800 m Höhe betrieben wir eine kleine Landwirtschaft. Im Winter arbeitete unser Vater Max Lopatar dann im Walde, und im Sommer vermieteten wir an Feriengäste. Landschaftlich war es ja so sehr schön bei uns. Für unsere Eltern war es nicht einfach bei der großen Kinderzahl; aber wir waren doch bis zum Kriege eine glückliche Familie. Auch in der Nachkriegszeit konnten wir zunächst in Wölfelsgrund bleiben. Aber dann brach es über uns herein. In der Nacht zum 28. August 1946 mussten wir binnen eineinhalb Stunden unser Haus verlassen. Vier Wochen waren wir unterwegs… Transport im Viehwagen… Lager in Immendorf…, und wir hatten auch noch unsere 75-jährige Oma und eine alleinstehende 83-jährige Nachbarin dabei, die aber den Transport nicht lebend überstand. Schließlich landeten wir in Immenrode, und mit uns die Familien Klinke und Hoffmann, die ebenfalls aus Wölfelsgrund kamen. Ach, was war das für ein schlimmer Anfang!
Aber ich will nicht klagen und keine alten Wunden aufreißen. Ich weiß ja auch nicht, wie ich mich heute verhalten würde, wenn uns so mir-nichts, dir-nichts eine neunköpfige Familie ins Haus gesetzt würde. Aber es gab ja doch einen großen Unterschied: Wir mussten alles aufgeben, hatten alles verloren, waren nicht freiwillig gekommen, und die Immenröder durften alles behalten.
Und es gab ja auch viel Verständnis und Hilfsbereitschaft. Da denke ich besonders an Willi Dietrichs und seine Frau. Das waren gute Menschen! Meine kleine Schwester und ich hatten dort unsere Schlafplätze. Jeden Abend legte uns Frau Helene Dietrichs angewärmte Steine ins Bett, damit wir es schön warm hatten, und zu Weihnachten 1946, als alles so knapp war, backte sie für unsere Familie einen ganzen Zuckerkuchen. Heute, wo wir alle im Überfluss leben, kann man natürlich nicht mehr ermessen, was damals ein ganzer Zuckerkuchen bedeutete!
Auf dem Wege zu unserer Schlafsteile kamen meine Schwester und ich jeden Abend an Kochs Garten vorbei. Dort arbeitete immer ein junger Mann, der uns freundlich grüßte und auch manchmal zuwinkte. Aber es dauerte noch ziemlich lange, bis wir miteinander ins Gespräch kamen. Und da staunte der Mann, dass ich auch so einiges von der Landwirtschaft und vom Gartenbau verstand. Ja, so fing es an. Im Juli 1947 lernten wir uns näher kennen, und am 22. November 1947 haben wir schon geheiratet. Das war eine Sensation für Immenrode: Ein einheimischer Bauer heiratet ein Flüchtlingsmädchen! Einige Monate später haben dann Kowalewskys das gleiche gewagt. Aber da war es umgekehrt, Henny war einheimisch und Ludwig ein Vertriebener…
Hertha Sodtke geb. Mielke (Jg.1927) berichtet:
Direkt vom Kriege hatten wir ja in Immenrode nicht viel gespürt. Bei Fliegeralarm gingen wir manchmal in den Keller von Hermann Prien. Unser Vater sagte aber: »Ich gehe lieber ins Feld. Da bin ich allein, und mir können keine Steine um die Ohren fliegen.« Aber einmal dachten wir, die Häuser stürzten ein und die Welt ginge unter. Das war, als die Amerikaner kamen und im Schimmerwald die Munitionslager gesprengt wurden. Wir wussten ja aber nicht, was los war, und haben uns zähneklappernd in Priens Keller verkrochen… Wir wollten gerade zum Graseberg hinausfahren, um Kartoffeln zu pflanzen. Beim Bahnwärterhaus hatte Hermann Meinecke Dienst und rief uns zu: »Maket, dat jei na Haus kumet, de Amerikaner sind schon in Hahnderp.« Und dann dauerte es auch nicht mehr lange, bis die Amis einrückten. Dort, wo jetzt Engelmanns wohnen, fuhr ein Panzer auf. Auguste Koch hatte als erste ein weißes Bettlaken aus dem Fenster gehängt, und viele taten das gleiche. Es fiel auch kein Schuss. Die Amerikaner suchten den Bürgermeister, aber der hatte vor Angst das Weite gesucht.
Darüber waren alle sehr wütend nach allem, was wir vorher mit ihm erlebt hatten. Und so wurde erst mal Wilhelm Fricke zum Bürgermeister ernannt. Einen Pastor gab es auch nicht in Immenrode. Otto Wedde musste die Beerdigungen halten…
Wilhelm Sodtke (Jg. 1923) erzählt:
Meine Eltern bewirtschafteten einen Hof in Seemark/Westpreußen. Als im Januar 1945 die Russen näherrückten, wurde von den Bewohnern ein Treck gebildet. Und das muss man sich einmal vorstellen: In dem bitterkalten Winter gelangten meine Eltern mit fünf von uns sieben Kindern (ein Bruder und ich waren Soldat) im Planwagen von Westpreußen bis nach Immenrode. Sogar unsere Pferde haben durchgehalten! Ich hatte mich bei Kriegsende bei einem Kameraden in der Gegend von Naumburg (DDR) versteckt.
Über allerlei Umwege erfuhr ich dann, wo meine Eltern und Geschwister geblieben waren. Da machte ich mich dann auch auf nach Immenrode. Meine Eltern berichteten, dass sie bei Hermann Frickes sehr freundlich aufgenommen wurden. Wir Kinder fanden dann auch bald Arbeit und Wohnung bei unseren Arbeitgebern…
Beide berichten weiter:
Nach den langen Kriegsjahren wollten wir jungen Leute natürlich auch mal wieder feiern und fröhlich sein. Und dazu wurde jede Gelegenheit genutzt. Beim Tanzen lernten wir uns kennen. Aber mit einer Heirat waren unsere Eltern zuerst ganz und gar nicht einverstanden. Eine Einheimische und ein Flüchtling – so etwas konnte doch nicht gut gehen! Aber dann mussten sie schließlich doch klein beigeben und gewöhnten sich auch bald an den Schwiegersohn aus Westpreußen. Die Eltern kauften dann den Schraderschen Hof, der bis dahin zur Mühle gehörte. Man kann sich heute kaum noch vorstellen, wer damals zusammen in unserem Haus wohnte. Da war einmal der alte Prien, der lebenslanges Wohnrecht hatte. Dann das Ehepaar Englert und Frau Minna Diederich. Und die Familie Scholz mit fünf Kindern… Bei so engem Zusammenleben war es gar nicht zu vermeiden, dass es auch zu Reibereien kam. Drei Parteien im Haus hielten Hühner. Welches Huhn hatte da wohin welches Ei gelegt? Aber vergessen wir das. Es wurde ja viel gebaut, die Wohnungsnot wurde geringer, und die Verhältnisse normalisierten sich. Inzwischen sind wir nun schon dreimal in Seemark gewesen, das jetzt natürlich zu Polen gehört. Und was wir kaum erwarten konnten: Wir wurden von den Polen mit einer solchen Herzlichkeit und Gastfreundschaft aufgenommen, eingeladen und bewirtet, dass wir ganz überwältigt waren…
Lucie Lüdtke geb. Giese (Jg. 1909) berichtet:
Wir bewirtschafteten einen Hof in Seemark/Westpreußen; unsere beiden Töchter Edelgard und Sigrun wurden 1941 und 1944 geboren. Mein Mann war Soldat, und so hatte ich die ganze Verantwortung. Aber ein Pole, der bei uns arbeitete, ein ehemaliger Student, hat mir bis zuletzt treu beigestanden. Im Januar 1945 rückte die Front immer näher. Wir entschlossen uns zur Flucht und bildeten mit den Bewohnern unseres Dorfes einen Treck von elf Gespannen. Unser Gespann übernahm Kurt Sodtke vom Nachbarhof, der ja leider hier in Immenrode so früh verstorben ist. Kurtchen war damals wohl gerade sechzehn Jahre alt. Die russischen Truppen waren uns so dicht auf den Fersen, dass wir sogar nachts weiterziehen mussten.
Einige Male gerieten wir auch ins Kampfgebiet und mussten Fliegerangriffe über uns ergehen lassen. Die Pferde eines Gespannes wurden getroffen, aber Gott sei Dank keine Menschen. Doch drei Dorfbewohner starben unterwegs; sie waren den Strapazen nicht gewachsen. Als wir an eine Oderbrücke kamen, war schon alles zur Sprengung vorbereitet. Wir sind mit unserem Treck gerade noch hinübergekommen; wenig später wurde die Brücke gesprengt, und dann wären wir mit unserem Treck auf östlicher Seite geblieben. In Pommern wurden wir dann sehr gastlich aufgenommen.
Trotz der vielen Flüchtlinge taten die Menschen dort alles, was sie konnten. Bis März 1945 zogen wir immer weiter, bis wir in einem Dorf bei Soltau für längere Zeit Halt machten. Von dort aus wurden wir dann – immer noch mit unseren Gespannen – nach Immenrode dirigiert. Sodtkes kamen zu Hermann Frickes, meine Schwester zu Samplebens und wir zu Papendiecks. Da waren wir ehemaligen Seemarker dicht beieinander und warteten nur auf Nachricht und auf die Heimkehr unserer Männer und Väter.
Arnold Lüdtke (Jg. 1908) erzählt:
Ich war in russischer Gefangenschaft und lebte in großer Sorge um meine Familie. Wir hatten ja erfahren, dass unsere Heimat zu Polen gekommen war und dass alle Deutschen vertrieben wurden. Ein Kamerad hatte schon Post von seinen Angehörigen, und an deren Adresse habe ich geschrieben. Das Rote Kreuz hat dann ermittelt, wo meine Familie geblieben ist. Im Mai 1948 wurde ich entlassen und konnte als Zielort schon Immen rode angeben. Meine Töchter erkannten mich nicht; sie kannten ja nur ein Soldatenbild vom Vater. Außerdem war mein Gesicht durch Wasser stark angeschwollen. Als erstes fragte ich meine Frau: »Hast du denn überhaupt was zu essen für mich?« Und sie zeigte mir ihren Kartoffelvorrat. Wir waren gesund und glücklich vereint und beteten voll Dankbarkeit: »Bis hierher hat mit Gott gebracht durch seine große Güte…« Aber wie sieht die Welt heute schon wieder aus? Es ist doch so, als ob die Menschheit aus allen schlimmen Erfahrungen nichts gelernt hätte…